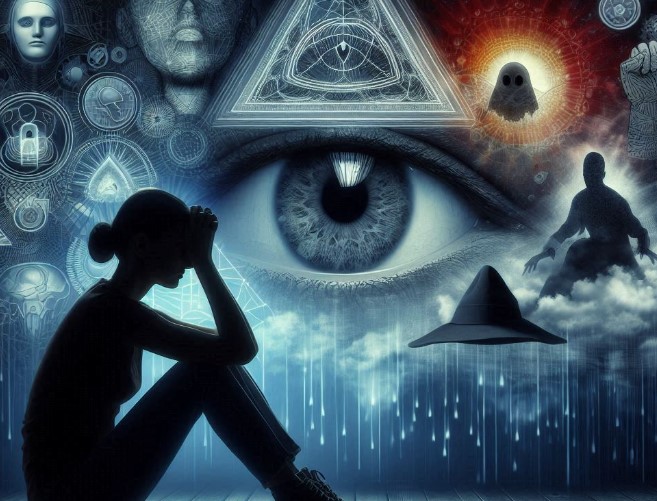Inmitten des Nachhalls des Chaos, das der Blackout hinterlassen hat – oder vielleicht immer noch unter den Folgen leidend, denn wenn die Normalität auf so drastische Weise verloren geht, braucht es Zeit, um zurückzukehren – bleibt uns in den meisten Fällen eine zentrale Frage: Wird es wieder passieren?
Am Montag um 12:31 Uhr geriet Spanien in eine Phase der Verwirrung, als ein großflächiger Stromausfall Millionen von Bürgern für einen Großteil des Tages ohne Strom ließ. Dieses Ereignis führte zu Problemen bei Verbindungen und im Verkehr und stellte nicht nur die Energieinfrastruktur, sondern auch das emotionale Gleichgewicht der Bevölkerung auf die Probe.
Psychologisch betrachtet könnten die Auswirkungen über die bloßen Unannehmlichkeiten des Alltags hinausgehen. Besonders gefährdete Menschen könnten in dieser Situation frühere kollektive oder individuelle Traumata erneut erleben. Experten betonen jedoch, dass wir auf unsere kollektive Widerstandsfähigkeit vertrauen können, insbesondere wenn wir Differenzen beiseitelegen und uns in Krisenzeiten gegenseitig unterstützen.
Mangel an Informationen
Der Stromausfall war für viele eine erhebliche Quelle der Angst. Ana María Núñez Rubines, Koordinatorin der Katastrophen- und Notfallinterventionsgruppe der Offiziellen Hochschule für Psychologie von Galicien (COPG), erklärt: „Es ist nicht nur so, dass wir keinen Strom haben, sondern dass plötzlich alle unsere Pläne durchkreuzt werden.“ Von der Unfähigkeit zu kochen über die Unmöglichkeit, sich aufgrund fehlender grundlegender Dienstleistungen wie Tankstellen fortzubewegen, bis hin zum Verlust der Kommunikation durch Ausfälle in den Mobilfunknetzen, führte der Blackout zu einem Gefühl der mangelnden Kontrolle, das sich emotional auswirkte.
Zu diesem Cocktail der Unsicherheit kamen auch die Falschmeldungen hinzu, die aufgrund des schwierigen Zugangs zu Informationen kursierten. In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich Theorien über das Ausmaß, die Dauer und den Ursprung des Stromausfalls, was Angst und Schrecken schürte. Der Psychologe warnt, dass es in solchen Zeiten unerlässlich ist, den Kontakt zu ungeprüften Informationen zu minimieren und sich auf offizielle Quellen zu stützen, da eine übermäßige Exposition gegenüber alarmierenden Nachrichten das Unbehagen nur verstärkt.
Verwundbarkeit und Resilienz
Sonia Gómez Pardiñas, Psychiaterin am Universitätsklinikum von A Coruña (Chuac), weist darauf hin, dass es zwar noch zu früh ist, um klinische Folgen des Blackouts zu erkennen, die emotionalen Auswirkungen auf besonders empfindliche Bevölkerungsgruppen jedoch nicht unterschätzt werden dürfen. „Ältere Menschen, insbesondere Alleinlebende, sowie Kinder und Jugendliche sind oft am anfälligsten für Situationen der Unsicherheit“, erklärt sie.
Darüber hinaus könnten Patienten mit einer Vorgeschichte von Angstzuständen oder psychischen Störungen eine Verschlimmerung ihrer Symptome erfahren haben. Gómez betont jedoch, dass nicht alle Folgen eines solchen Ereignisses sofort sichtbar sind; einige Effekte könnten sich erst im Laufe der Zeit zeigen.
Für viele war der Stromausfall am Montag „ein weiteres Ereignis“ in einer Reihe von Krisen, die die letzten Jahre geprägt haben: von der Covid-19-Pandemie über die DANA in Valencia bis hin zu bewaffneten Konflikten und dem Klimawandel. Núñez weist darauf hin, dass solche Ereignisse die Bevölkerung psychisch anfälliger machen können. Wie der Experte erklärt, kann die Wahrnehmung, dass eine Reihe von Widrigkeiten angehäuft wurde, das Gefühl der kollektiven Hilflosigkeit verstärken und eine Haltung der ängstlichen Resignation gegenüber zukünftigen unerwarteten Ereignissen hervorrufen.
Zudem kann ein Ereignis wie dieses alte Wunden wieder aufreißen. „Als zum Beispiel Covid-19 passierte, erlebten Menschen, die in der Nachkriegszeit hungern mussten, diese Szenen erneut. Man ging in den Supermarkt und fand keine bestimmten Produkte. Für andere, die nicht in dieser Lage waren, mag das vielleicht nicht so schlimm sein. Sie gehen nicht einkaufen, und das war’s. Auf der anderen Seite können diejenigen, die eine traumatische Nachkriegssituation durchlebt haben, große Angst vor dieser Erinnerung an ihr Trauma empfinden“, erklärt Josep Vilajoana, Koordinator der Abteilung Gesundheitspsychologie des Allgemeinen Rates für Psychologie.
Insgesamt ermöglichen uns solche Ereignisse, unsere kollektive Widerstandsfähigkeit zu erkennen und unsere Fähigkeit zu schätzen, um besser auf zukünftige Probleme vorbereitet zu sein. Einige Menschen ergreifen bereits Präventionsmaßnahmen, besorgen sich Notfallsets und erstellen Aktionspläne für den Fall, dass sich diese Situation wiederholt. Dies spiegelt eine aktive und anpassungsfähige Haltung gegenüber der Unsicherheit wider. Solche Reaktionen können die emotionalen Auswirkungen zukünftiger Eventualitäten abmildern.
„Unsicherheit ist immer ein Faktor, der Stress erzeugt. Die direkten Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hängen jedoch von der individuellen Veranlagung ab. Frühere Erfahrungen bieten uns einen gewissen Schutz und geben uns zumindest einige Werkzeuge, um mit dieser Art von Situation umzugehen“, sagt Dr. Gómez.
„Ich würde empfehlen, dass die Schwächsten versuchen, nicht vorherzusehen, was passieren könnte, ihren Kopf mit anderen Themen zu beschäftigen und sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren, anstatt sich über mögliche zukünftige Ereignisse den Kopf zu zerbrechen, die vielleicht nie eintreten werden“, rät der Psychiater. Darüber hinaus betont er die Wichtigkeit, in Stresssituationen eine Überbelastung mit Informationen zu vermeiden und die am stärksten gefährdeten Menschen zu unterstützen.
Eines der störendsten Elemente des Blackouts war der Verlust der Internetverbindung und der Zusammenbruch der Mobilfunknetze. Diese plötzliche Isolation war vor allem für die Jüngeren schwer zu verkraften. „Patienten, die stark von sozialen Netzwerken oder dem Spielen von Videospielen abhängig sind, hatten es besonders schwer“, sagt Núñez. Der Experte geht davon aus, dass die erzwungene Unterbrechung des digitalen Zugangs in den kommenden Tagen ein wiederkehrendes Thema in der Beratung sein wird. Gómez weist zudem darauf hin, dass der Verlust der Verbindung bei Menschen, die bereits dafür anfällig sind, Ängste auslösen kann.
Im psychosozialen Kontext kann Information als ein Grundbedürfnis verstanden werden. „Wenn wir uns an die Maslowsche Bedürfnispyramide erinnern, stehen an der Basis die grundlegendsten Bedürfnisse: Essen und Schlafen. Etwas weiter oben gibt es eine Decke, die sowohl physisch als auch psychisch ist. Das bedeutet, dass Menschen, die uns unterstützen, auch zu dieser Decke gehören. Informationen, die Sicherheit bieten, fallen ebenfalls unter diese psychologische Obergrenze. Wenn beispielsweise sofort gesagt wird, dass die Krankenhäuser Generatoren haben und ausreichend versorgt sind, beruhigt das die Menschen“, erklärt Vilajoana.
Ein unvorbereitetes System
Einer der kritischen Punkte, die beide Spezialisten beobachten, ist die unzureichende strukturelle Vorbereitung des psychischen Gesundheitssystems auf den Umgang mit solchen Ereignissen. Núñez betont die Notwendigkeit, die Rolle von Psychologen in Primärversorgungszentren und Bildungseinrichtungen angemessen zu integrieren und sofortige Ressourcen für diejenigen bereitzustellen, die sie am dringendsten benötigen – besonders in Situationen wie diesen.
Dies ist besonders wichtig, wenn es um die Betreuung von Kindern geht, da sie den Blackout möglicherweise als beunruhigende und belastende Erfahrung erlebt haben. Núñez schlägt vor, dass Psychologen im schulischen Umfeld nicht nur zur Bewältigung spezifischer Krisen beitragen, sondern auch von klein auf dauerhafte emotionale Werkzeuge entwickeln könnten.
Die Bedeutung der Gemeinschaft
Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass soziale Unterstützungsnetzwerke als Puffer gegen Stress und Traumata fungieren. Aus diesem Grund betont Núñez, wie wichtig es ist, die Bindungen zu den Gemeinschaften zu stärken: „Ein gutes Unterstützungsnetzwerk hilft uns, unsere Bewältigungsstrategien zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit zu kultivieren, von der wir so oft sprechen.“
In Krisensituationen kann es beruhigend sein, einfach das Haus zu verlassen und die Nachbarn zu sehen oder an der Tür zu plaudern. Paradoxerweise war der Stromausfall in diesem Sinne eine Erinnerung an die Bedeutung menschlicher Bindungen. „Die Rolle des gemeinschaftlichen Umfelds besteht darin, zu unterstützen und zu begleiten, wenn nötig. Je weniger isoliert wir in diesen Situationen sind, desto besser – wenn wir mit Familie, Nachbarn oder Freunden zusammen sein können, hilft uns das allen“, sagt Vilajoana.
Strategien angesichts des Unvorhergesehenen
Der Stromausfall am Montag hat emotionale Spuren hinterlassen, die in einigen Fällen angegangen werden müssen. Emotionen wie Angst, Frustration, Hilflosigkeit oder Unruhe sind zwar normale Reaktionen auf das Unerwartete, aber wenn sie anhalten oder eskalieren, ist es ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es wird zudem empfohlen, einen Psychologen oder Psychiater aufzusuchen, wenn Schlafprobleme auftreten – eine häufige Komplikation nach psychisch belastenden Ereignissen.
„Die verzweifelte Suche nach Informationen ist eine Praxis, die wir aufgeben sollten. Es ist nicht gesund, ständig zu lesen oder in soziale Netzwerke oder auf das Mobiltelefon zuzugreifen. In Ausnahmesituationen wie diesen ist es besser, einen vertrauenswürdigen, offiziellen Kanal zu wählen und die Informationen, die er uns gibt, zu nutzen, um den Lärm so weit wie möglich zu reduzieren. Angst führt dazu, dass wir die möglichen Bedrohungen überbewerten. Daher kann es auch hilfreich sein, Atem- und Entspannungsübungen zu machen, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Wir sollten nicht vergessen, dass solche Ereignisse nicht von uns abhängen“, rät Vilajoana.
Schließlich empfiehlt er, sich auf zukünftige Ereignisse vorzubereiten. „Die Lehren, die wir aus dieser Situation ziehen können, um beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein, werden sich nur zeigen, wenn wir die Situation akzeptieren. Es ist wenig hilfreich, sie zu leugnen und zu glauben, dass es nicht wieder passieren wird, auch wenn das verständlich ist, da es dem menschlichen Wunsch entspricht“, schließt der Experte.
Die Psychologin Lara Ferreiro gibt wertvolle Tipps, um mit dem Heiligenschein der Unsicherheit und der Angst umzugehen, die in solchen Situationen entstehen können. Sie weist darauf hin, dass „60 % der Spanier bereits psychische Symptome erlebt haben, die durch den Blackout ausgelöst wurden, oder in den kommenden Tagen erleben werden“. Ferreiro beschreibt die gegenwärtige Situation als „historischen Moment“ und bezeichnet sie als den „absoluten Nullpunkt“, was so noch nie zuvor geschehen ist. Es sei entscheidend, zu lernen, wie man damit umgeht.
Zunächst stellt sie klar, dass wir eine Phase der „agonischen Trauer“ durchleben werden. Zunächst erleben wir Schock, gefolgt von einer ein- bis zweitägigen Phase der Angst während der Anpassung. Schließlich treten wir in die Phase des „Das ist bereits geschehen“ ein. Dieser Prozess kann etwa einen Monat in Anspruch nehmen. Nach diesem Zeitraum empfiehlt sie, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Zu den möglichen Symptomen gehören Stress, Angst, Klaustrophobie in der U-Bahn oder im Aufzug, Hyperwachsamkeit bezüglich der Zukunft, „FOMO“ (Angst, etwas zu verpassen, weil man kein Handy hat) sowie apokalyptische Paranoia über zukünftige Ereignisse und unkontrollierbare Hypochondrie. Diese Gefühle können in den kommenden Tagen verstärkt auftreten, erklärt sie. Zudem können Schlafstörungen und sogar „Retraumatisierungen“ auftreten, das heißt, die Rückkehr unangenehmer Stimmungen, die wir während der Pandemie erlebt haben. Die Liste der psychischen Probleme wird laut Ferreiro nicht kurz sein.
Wie können wir also mit diesem „Rudel“ umgehen, das auf uns zukommt?
Stell dir vor, dieses “Rudel” ist wie eine Welle von Ungewissheit und potenziellen Schwierigkeiten, die auf uns zurollt. Wie stellen wir uns dem entgegen, ohne von ihr überrannt zu werden?
Zuerst einmal: Wir lassen die Emotionen zu, die in dieser ersten Phase hochkommen werden. Es ist absolut in Ordnung, sich unsicher oder ängstlich zu fühlen, wenn sich die Dinge verändern. Das ist menschlich. Wir versuchen nicht, diese Gefühle wegzudrücken, sondern erkennen sie an, wie ein erfahrener Wanderer, der das Wetter akzeptiert, wie es ist.
Dann: Wir aktivieren unser inneres “Mönchsgesetz”. Das bedeutet, wir konzentrieren uns auf den gegenwärtigen Moment, auf den nächsten Schritt, den wir tun können. Anstatt uns in möglichen Horrorszenarien zu verlieren, bleiben wir im Hier und Jetzt. Was können wir jetzt tun? Welche kleine Aufgabe können wir jetzt bewältigen?
Für die praktische Vorbereitung: Wir schnüren ein kleines Basispaket – ein paar haltbare Lebensmittel, Batterien, vielleicht ein Erste-Hilfe-Set. Aber wir verfallen nicht in Panikkäufe. Wir handeln besonnen, wie jemand, der sich auf eine Wanderung vorbereitet: mit dem Nötigsten, ohne unnötigen Ballast.
Wenn die Welle der Angst doch einmal hochschwappt: Dann nutzen wir unsere Atemanker. Die 5×5-Atmung ist wie ein stiller Hafen in stürmischer See. Fünfmal tief einatmen, fünfmal langsam ausatmen – das holt uns zurück ins Gleichgewicht, in den gegenwärtigen Moment.
Um uns nicht in den Fluten falscher Informationen zu verlieren: Schaffen wir uns eine “Informations-Entgiftung”. Wir suchen uns verlässliche Quellen und meiden alles, was nur Panik schüren will. Klare, vertrauenswürdige Informationen sind wie ein Leuchtturm, der uns den Weg weist.
Und schließlich: Geben wir uns selbst eine Schonfrist. Wenn uns bestimmte Dinge im Moment Angst machen, zwingen wir uns nicht sofort dazu. Aber wir bleiben wachsam. Nach dieser ersten Woche beobachten wir uns selbst. Entwickeln wir Vermeidungsstrategien? Dann ist es wichtig, sanft aber bestimmt daran zu arbeiten, nicht in diese Muster zu verfallen. Es ist wie nach einer Verletzung: Wir geben uns Zeit zu heilen, aber wir sorgen dafür, dass die Muskeln nicht verkümmern.
So gehen wir mit diesem “Rudel” um: achtsam, vorbereitet und mit dem Fokus auf den gegenwärtigen Moment, während wir gleichzeitig unsere Emotionen anerkennen und uns vor unnötiger Angst schützen. Was denkst du dazu? Gibt es noch einen Aspekt, den wir genauer betrachten sollten?
Abonniere unseren Newsletter