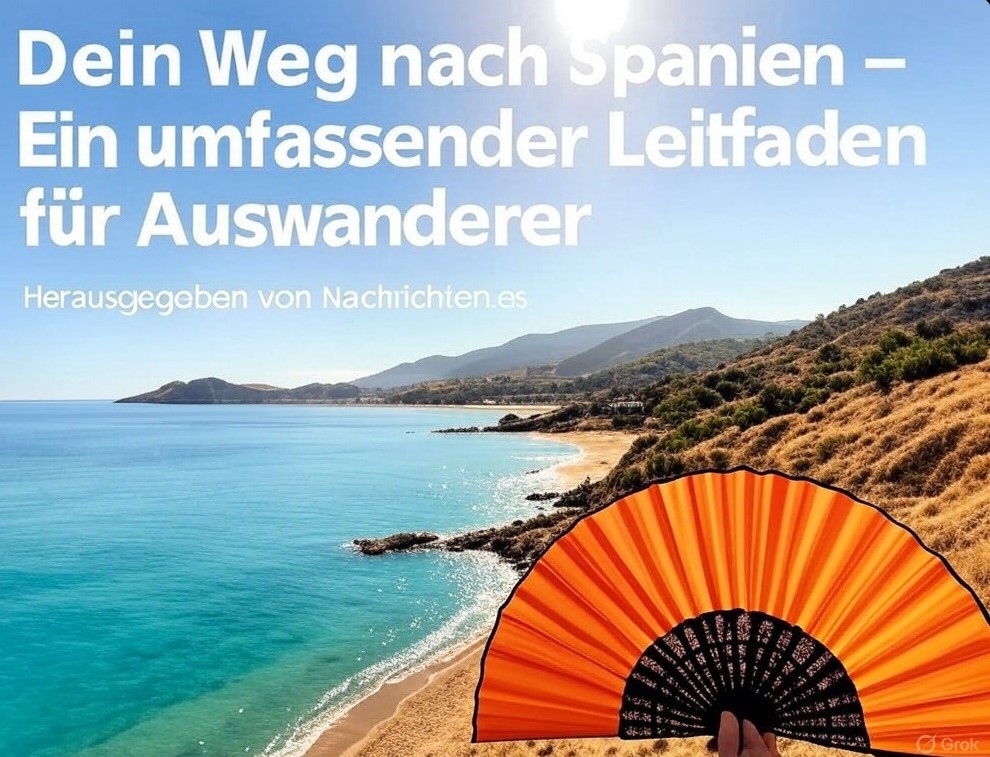Manche Gesetze sind wie Wasser, sie löschen Brände. Andere sind wie Benzin, sie entzünden sie erst richtig. In Spanien, einem Land, das die Kunst perfektioniert hat, Gesetze zu erlassen, die an der Realität zerschellen, haben wir es leider viel zu oft mit der zweiten Sorte zu tun. Jedes Mal, wenn das Privateigentum ausgehöhlt und die individuelle Verantwortung durch staatliche Gängelung ersetzt wird, explodieren die Probleme. Der Staat neigt dazu, ein schlechtes Gesetz mit einem noch schlechteren zu überdecken – ein verzweifelter Versuch, ein Feuer mit mehr Brennstoff zu bekämpfen.
Das fatale Erbe: Eigentum ohne Rechte
Den Anfang machte das Forstgesetz von 1957, das der privaten Bewirtschaftung von Wäldern jahrzehntelang einen Riegel vorschob. Einen Wald zu besitzen, bedeutete nicht, über ihn bestimmen zu dürfen. Jede Aktivität war strengstens reguliert, jede Nutzung stand unter dem wachsamen Auge der Verwaltung. Das oberste Ziel des Gesetzes: Das Land auf ewig als “Wald” zu deklarieren und die Tür für jegliche alternative Nutzung zu verschließen. Das Ergebnis war ein Eigentum, das seines Inhalts beraubt wurde. Die Eigentümer trugen alle Lasten, genossen aber kaum legitime Vorteile.
Ein Großteil der Waldbrände in Spanien ist das Werk von Brandstiftung. Das Gesetz von 1957 verhinderte nicht, dass verbranntes Land umgewidmet wurde. Vieles hing vom Ermessen der Stadtplanung und nachfolgenden Verwaltungsentscheidungen ab. Diese Lücke öffnete Tür und Tor für den Verdacht, dass Brände absichtlich gelegt wurden. Sobald eine Fläche verbrannt war, verlor sie ihren forstwirtschaftlichen Wert und wurde plötzlich für Bauprojekte oder Landwirtschaft interessant. Jeden Sommer, wenn die Flammen über die Hügel tanzten, raunten Stimmen von Bauinteressen, die im Rauch auf ihre Chance lauerten.
Die 30-Jahres-Falle: Ein Gesetz, das Sabotage belohnt
Um diesem Treiben ein Ende zu setzen, wurde 2003 ein neues Forstgesetz als die große Modernisierung gefeiert. Doch es löste das Kernproblem nicht, sondern verschärfte es. Die wichtigste Neuerung war die sogenannte “Dreißig-Jahres-Regel”: Brennt ein Wald, darf er für drei Jahrzehnte weder umgewidmet noch einer anderen Nutzung zugeführt werden. Die Logik schien simpel: Ohne Aussicht auf Profit nach einem Feuer verschwindet der Anreiz zur Brandstiftung.
Diese Maßnahme verlagerte die Anreize jedoch nur. Niemand würde mehr ein Feuer legen, um Bauland zu schaffen. Stattdessen eröffnete das Gesetz eine neue, finstere Möglichkeit: die Sabotage. Stellen Sie sich ein Grundstück vor, das kurz vor der Umwidmung steht. Ein Konkurrent, der das Projekt blockieren will, müsste es nur in Brand setzen. Sobald die Flammen lodern, bevor der letzte Stempel auf dem Papier ist, ist das Projekt für dreißig Jahre gestorben.
Spaniens Wälder: Vernachlässigte Pulverfässer
Die perversen Anreize zur Brandstiftung sind aber nur ein Teil des Problems. Die viel wichtigere Konsequenz der spanischen Forstgesetze liegt nicht darin, warum Brände entstehen, sondern warum sie sich mit solch verheerender Gewalt ausbreiten. Jahrzehntelange gesetzliche Fesseln haben die Wälder in riesige, ausgetrocknete Brennstofflager verwandelt. Was diese Brände zu nationalen Katastrophen macht, ist die Tatsache, dass sie, einmal entfacht – ob durch Zufall oder Absicht – auf Wälder treffen, die durch gesetzliche Vorgaben zur Verwahrlosung verdammt wurden.
Ein Feuer braucht Nahrung. Trockene Biomasse, herabgefallene Äste und brennbares Unterholz sind der wahre Treibstoff für die Apokalypse. Diese Ansammlung ist kein Zufall, sondern das direkte Ergebnis einer Gesetzgebung, die seit Jahrzehnten die Vernachlässigung fördert. Das Gesetz schreibt den Eigentümern vor, Brände zu verhindern, entzieht ihnen aber gleichzeitig jeden Anreiz und jede Möglichkeit dazu. Stattdessen werden sie mit Kosten, Bürokratie und Strafen überhäuft. Ein Vermögenswert, der nur Ausgaben verursacht, aber keine Einnahmen generiert, wird unweigerlich aufgegeben.
Das jährliche Ritual der Ohnmacht
Früher sorgten Hirten mit ihren Herden, Holzfäller und Anwohner, die Brennholz sammelten, für saubere Wälder. Heute sind diese Praktiken verboten oder in einem Sumpf aus Genehmigungen begraben. So sind diejenigen, die das größte Interesse am Erhalt des Landes hätten, die Eigentümer, faktisch enteignet worden. Der Wald gehört niemandem mehr: nicht den Besitzern, die ihn nicht bewirtschaften dürfen; nicht den traditionellen Nutzern, die nicht mehr von ihm profitieren; und nicht dem Staat, dem die Mittel zur Pflege fehlen.
Und so wiederholt sich jeden Sommer das gleiche, tragische Ritual: Hubschrauber knattern am Himmel, das Fernsehen liefert dramatische Bilder von unaufhaltsamen Flammen, Feuerwehrleute kämpfen bis zur Erschöpfung und Politiker posieren betroffen in der Asche für die Kameras. Die Szene wiederholt sich Jahr für Jahr, begleitet von den üblichen Reformversprechen. Währenddessen wächst das Unterholz still und leise weiter, trocken und bereit, und wartet auf den nächsten Funken. Das Feuer wird nicht warten, und dieses Gesetz wird es nicht aufhalten.
Abonniere unseren Newsletter