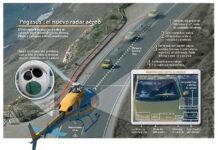Gesundheitsdienste alarmiert über Dunkelziffer bei FGM-Überlebenden
In den vergangenen fünf Jahren haben die Gesundheitsdienste von Gran Canaria insgesamt 191 Fälle von Frauen und Mädchen dokumentiert, die Opfer weiblicher Genitalverstümmelung (FGM) wurden. Fachleute warnen jedoch, dass die tatsächliche Zahl noch deutlich höher sein könnte, da viele betroffene Frauen aus Gemeinschaften stammen, in denen FGM stark verbreitet ist – wie etwa in Mauretanien, wo rund 65 % der Frauen zwischen 15 und 49 Jahren betroffen sind.
Besonders besorgniserregend: Unter den registrierten Fällen befinden sich auch Minderjährige.
Erste Strategien seit der Pandemie
Artemi Dámaso, Hebamme im Primary Care Management von Gran Canaria, stellte die Daten beim Vorkongresstisch der XLIII. Jahrestagung der Spanischen Gesellschaft für Epidemiologie sowie des XX. Portugiesischen Epidemiologie-Kongresses vor.
Im Gespräch mit EFE erklärte sie, dass die Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 ein Wendepunkt gewesen sei. Damals begannen die Gesundheitsdienste, Migrantinnen gezielt zu befragen – auch zu FGM. Viele Frauen gaben offen zu, betroffen zu sein, was zur Entwicklung eines ersten Hilfsleitfadens für Fachpersonal führte, erarbeitet gemeinsam mit afrikanischen Frauenverbänden wie Dimbe.
Dieser Leitfaden hilft medizinischem Personal dabei, die richtigen Fragen zu stellen und die spezifischen Bedürfnisse der Frauen zu erkennen.
Chronische gesundheitliche Folgen
FGM hat schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen:
- Inkontinenz und wiederkehrende Harnwegsinfektionen
- Schmerzen bei Geschlechtsverkehr und Menstruation
- Verlust sexueller Lust
Auch wenn manche Symptome durch Physiotherapie oder Schmerzbehandlung gelindert werden können, bleiben viele Folgen lebenslang bestehen.
„Das Schlimmste ist, dass viele dieser Frauen nicht nur Opfer von Verstümmelung sind, sondern auch von sexueller Gewalt, geschlechtsspezifischer Unterdrückung, wirtschaftlicher Ausbeutung und Menschenhandel“, so Dámaso.
Schwierige Betreuung durch Migration und Sprachbarrieren
Die Frauen nehmen Hilfe meist positiv an, doch eine kontinuierliche Betreuung ist schwierig, da viele nicht dauerhaft auf den Kanarischen Inseln bleiben, sondern in andere Länder weiterziehen.
Ein weiteres Hindernis sind sprachliche und kulturelle Barrieren. Dámaso betont daher die Rolle von Kulturvermittlern, die zwischen Patientinnen und dem Gesundheitssystem vermitteln.
Weltweites Problem mit Millionen Betroffenen
Laut Schätzungen der WHO haben weltweit etwa 200 Millionen Frauen und Mädchen weibliche Genitalverstümmelung überlebt. Während manche Gemeinschaften die Praxis noch verteidigen, kämpfen andere Frauen aktiv dagegen und wandern aus, um ihre Töchter davor zu schützen.
Dámaso fordert, dass medizinisches Personal sensibilisiert wird und den Mut hat, betroffene Frauen direkt anzusprechen: „Nur so können wir ihre Leiden erkennen und gemeinsam Lösungen finden.“
Folge uns auf WhatsApp für die wichtigsten Nachrichten aus Spanien in Echtzeit.
Abonniere unseren Newsletter