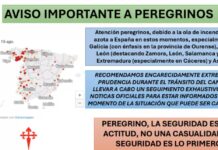Wenn wir an einen Feuerwehrmann denken, sehen wir einen Helden vor uns, der fähig ist, Waldbrände zu löschen oder Menschen aus brennenden Häusern, überfluteten Gebieten und Unfallwracks zu retten. Doch hinter dieser Fassade aus Mut und Stärke verbirgt sich eine unsichtbare Belastung, über die nur wenige sprechen: der immense psychologische und emotionale Tribut, den dieser Beruf fordert. Das Burnout-Syndrom – ein Zustand totaler emotionaler Erschöpfung, Depersonalisierung und dem Gefühl schwindender beruflicher Effektivität – hat sich zu einer wachsenden Bedrohung für diese systemrelevanten Arbeitskräfte in Spanien entwickelt. Eine umfassende Analyse von 36 Studien zu diesem Thema bestätigt eine alarmierende Realität: Emotionale Erschöpfung ist in der Gemeinschaft der Feuerwehrleute weit verbreitet. Paradoxerweise ist die Forschung dazu, im Vergleich zu anderen Hochrisikoberufen wie Polizisten oder medizinischem Personal, noch immer erschreckend spärlich.
Risiken, die weit über das Feuer hinausgehen
Der Arbeitstag eines Feuerwehrmanns wie Ricardo beginnt mit dem Wissen, dass er erst 24 Stunden später wieder nach Hause kommen wird. Während die meisten einen geregelten Acht-Stunden-Tag haben, bedeutet eine Schicht bei der Feuerwehr, rund um die Uhr verfügbar, wachsam und einsatzbereit zu sein. Diese ständige Anspannung ist zermürbend, denn die Arbeit geht weit über das Löschen von Bränden hinaus.
An einem Tag müssen sie die Tür für eine ältere Person aufbrechen, die nicht mehr auf Anrufe reagiert, um festzustellen, ob sie noch am Leben ist. Am nächsten Tag bekämpfen sie ein Gasleck, greifen bei einem schweren Verkehrsunfall ein oder leisten Beistand bei einem Selbstmordversuch. Ihr Alltag ist von unvorhersehbaren und oft traumatischen Ereignissen geprägt. Jeder Einsatz erfordert nicht nur technisches Können, sondern auch ein Höchstmaß an emotionaler Kontrolle, Empathie und die Fähigkeit, unter extremem Druck zu handeln. Theoretisch könnten sie nachts schlafen, doch die Realität sieht anders aus: Der Alarm kann jederzeit schrillen und sie aus dem Schlaf reißen.
Zu den Hauptauslösern für Burnout zählen die übermäßigen Arbeitsanforderungen, die ständige Konfrontation mit Notfallsituationen, die langen Schichten und unklare Rollenverteilungen. Verschärft wird dies durch mangelnde institutionelle Anerkennung und eine geringe organisatorische Unterstützung, die die Fachkräfte zusätzlich zermürbt.
Nicht alle Feuerwehrleute sind gleichermaßen gefährdet
Die Anfälligkeit für Burnout ist individuell verschieden. Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie Neurotizismus, ein geringes Gefühl der Selbstwirksamkeit und vermeidende Bewältigungsstrategien erhöhen das Risiko erheblich. Im Gegensatz dazu wirken Faktoren wie eine hohe emotionale Intelligenz und die Fähigkeit, einen tieferen Sinn in der eigenen Arbeit zu finden, wie ein Schutzschild gegen die emotionale Zermürbung.
Die verheerenden Folgen: Von Müdigkeit bis zu schweren Verletzungen
Burnout ist weit mehr als nur Müdigkeit oder Demotivation. Die Konsequenzen beeinträchtigen die Gesundheit des Feuerwehrmanns und damit auch die Sicherheit der Gemeinschaft, der er dient, massiv. Studien belegen einen klaren Zusammenhang zwischen Burnout und psychischen Störungen wie Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und chronischen Schlafstörungen.
Auch auf körperlicher Ebene hinterlässt die emotionale Erschöpfung Spuren. Sie wird mit einem erhöhten Risiko für Muskel-Skelett-Verletzungen in Verbindung gebracht. Zudem wirkt sich Burnout negativ auf die Arbeitsleistung aus, was die Wahrscheinlichkeit von Fehlern, Fehlzeiten am Arbeitsplatz und Sicherheitsproblemen drastisch erhöht.
Das Paradoxon der Berufung und die Situation in Spanien
Man könnte annehmen, dass eine starke Berufung schützt. Doch unter bestimmten Umständen kann genau diese Leidenschaft zum Verhängnis werden. Sie kann die emotionale Wucht kritischer Situationen verstärken und in Kontexten hoher affektiver Belastung zu einem Risikofaktor werden. Ähnlich verhält es sich mit der sozialen Unterstützung durch Kollegen: In einem angespannten oder schlecht geführten organisatorischen Umfeld kann sie wirkungslos oder sogar schädlich sein und die emotionale Erschöpfung noch verschlimmern.
Trotz der Schwere des Problems ist Burnout in Spanien nicht als Berufskrankheit anerkannt. Dies verhindert, dass betroffene Feuerwehrleute die notwendige Unterstützung und spezifische Schutzmaßnahmen erhalten. Diese gesetzliche Lücke steht im krassen Gegensatz zu Ländern wie Schweden oder Kanada, wo strukturierte Präventionsprotokolle wie das CISM-Modell (Critical Incident Stress Management) fest etabliert sind.
Besorgniserregend ist zudem der Mangel an Studien, die sich mit der Situation in Spanien befassen. Dies erschwert die Entwicklung einer Politik, die an die spezifischen Bedürfnisse des Landes angepasst ist – eine Lücke, die angesichts der Zunahme von Extremwetterereignissen wie der DANA 2024, die die Anforderungen an diese Berufsgruppe weiter vervielfachen, noch gravierender wird.
Fürsorge für die, die sich um uns kümmern
Es ist höchste Zeit zu handeln. Auf individueller Ebene könnten Trainingsprogramme zur emotionalen Regulation, zur Stärkung der Resilienz und zum Erlernen aktiver Bewältigungsstrategien einen großen Unterschied machen. Auf organisatorischer Ebene sind Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsumfelds unerlässlich: klare Rollendefinitionen, eine ausgewogene Arbeitsbelastung und eine stärkere, unterstützende Führung.
Burnout bei Feuerwehrleuten ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine logische Konsequenz aus einem Arbeitsumfeld, das konstant ein extremes Maß an emotionaler Kraft fordert. Die Anerkennung von Burnout als psychosoziales Risiko und die Entwicklung öffentlicher Präventions- und Hilfsangebote sind längst überfällig. Die psychische Gesundheit derer, die uns täglich schützen, darf nicht länger ignoriert werden. Es ist nicht nur eine Frage der Arbeitsgerechtigkeit, sondern eine der sozialen Verantwortung.
Abonniere unseren Newsletter