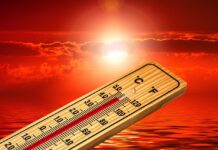Ein neuer, brisanter Tierrechtsbericht rückt Spaniens sogenannte „Makrofarmen“ in den Fokus und entfacht die Debatte um die Zukunft der europäischen Viehzucht neu. Die Organisation AGtivist hat einen Bericht vorgelegt, der die Existenz von über 22.263 industriellen Hühner- und Schweinefarmen in der EU anprangert, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Spanien. Das Land soll in den letzten zehn Jahren das größte Wachstum in diesem Sektor verzeichnet haben.
AGtivist-Bericht: Zahlen und Vorwürfe
Der Bericht von AGtivist, einer bekannten Tierrechtsorganisation, die sich klar gegen das Intensivmodell der Viehzucht positioniert, liefert detaillierte Zahlen. Demnach gibt es in der Europäischen Union 10.862 Geflügelfarmen mit jeweils mindestens 40.000 Vögeln und 8.854 Schweinefarmen mit jeweils mindestens 2.000 Schweinen. Bemerkenswert ist, dass 2.547 dieser Schweinefarmen auf die Haltung von Zuchtschweinen spezialisiert sind.
Besonders hervorzuheben ist das Wachstum der letzten Dekade: „2.746 Mega-Betriebe wurden in der EU in Betrieb genommen, wobei die höchste Entwicklungsrate in Spanien verzeichnet wurde, wo in den letzten zehn Jahren 1.385 neue industrielle Betriebe gegründet wurden“, so der Bericht. Weiterhin führt er aus, dass „Spanien mit 2.580 Mast- und 821 Zuchtbetrieben die größte Anzahl industrieller Schweinezuchtbetriebe hat.“ Diese Zahlen ähneln frappierend den Daten des Jahresberichts 2023 des spanischen Landwirtschaftsministeriums.
📢 Folge uns in unseren Netzwerken:
🐦 X |
📘 Facebook |
💬 WhatsApp |
📲 Telegram
👉 Oder melde dich für unseren
📩 Newsletter an.
⭐️ Gerne kannst du auch
Premium-Mitglied werden.
Das Ministerium unterstreicht die Bedeutung des Schweinesektors für die spanische Landwirtschaft und ländliche Wirtschaft. Mit über 86.000 Betrieben und einem Bestand von mehr als 30 Millionen Tieren ist dieser Sektor ein Pfeiler der nationalen Wirtschaft. Obwohl es keine offizielle Definition des Begriffs „Makrobetrieb“ gibt, schätzt das Ministerium, dass etwa 3.217 Betriebe die Kriterien für „groß“ erfüllen, also solche, die mehr als 2.000 Mastschweine (über 30 kg) oder über 750 Zuchtsauen halten.
Strukturelle Ungleichheit und regulatorischer Druck
Der AGtivist-Bericht stellt auch eine besorgniserregende strukturelle Ungleichheit fest: Während die Zahl und Größe der „Mega-Farmen“ in der EU zunimmt – ein Anstieg von 56 % zwischen 2005 und 2020 – sind im gleichen Zeitraum über 5,3 Millionen kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe verschwunden, was einem Rückgang von 44 % entspricht.
Allerdings, so die kritische Einordnung, ist es zu einfach, ausschließlich große Farmen für dieses Verschwinden verantwortlich zu machen. Der Bericht ignoriert dabei den erheblichen Druck, der von der Tierlobby ausgehenden Regeln ausgeübt wird. Beispiele hierfür sind das Ende der Käfighaltung, die Reduzierung der erlaubten Tierzahlen und neue Anforderungen an den Transport von lebenden Rindern. Dieser regulatorische Druck, gepaart mit einem erstickenden bürokratischen Aufwand, schafft ein schwieriges Umfeld für Familienbetriebe mit begrenzten Ressourcen und trägt zu deren Verschwinden bei.
Die Tierschutzdebatte: Fakten und Kampagnen
Der Tierrechtsbericht beklagt, dass in der EU mehr als 516 Millionen Tiere unter prekären Bedingungen industrieller Ausbeutung leben. Bezüglich Spaniens heißt es: „Die lokale Forschung zeigt die Konzentration von Schweinen in Intensivbetrieben, wo sie unter überfüllten und unhygienischen Bedingungen leben und ohne Behandlung Verletzungen und Krankheiten erleiden.“
Kritiker bemängeln, dass der Bericht nicht zwischen legalen, gut geführten landwirtschaftlichen Betrieben und vereinzelten Fällen von Fehlverhalten unterscheidet. Ebenso wenig wird der jährliche Tierschutzbericht 2024 des Landwirtschaftsministeriums erwähnt, in dem festgestellt wird, dass „die spanische Viehzucht strenge Vorschriften zum Tierschutz und zur ökologischen Nachhaltigkeit einhält und durch amtliche Kontrollen überwacht wird.“
Führende Tierrechtsverbände, wie die Eurogroup for Animals, nutzen diesen Bericht, um ihre Kampagne zur Kriminalisierung des Fleischkonsums und zur Reduzierung oder Abschaffung von landwirtschaftlichen Betrieben voranzutreiben. Dabei werden die potenziellen Auswirkungen auf die ländliche Umwelt, die Beschäftigung, die europäische Ernährungssouveränität oder die individuelle Freiheit oft außer Acht gelassen.
Abonniere unseren Newsletter